Klimaanpassung in der Wiener Stadtentwicklung: Im Gespräch mit Stephanie Drlik

© Stadt Wien/Gerd Götzenbrucker
Zwischen 10. und 12. April treffen sich internationale LandschaftsplanerInnen am Nordwestbahnhof zu einem Symposium. „Designing Green & Resilient Cities“ ist das große Thema. Ein Vorab-Gespräch mit Geschäftsführerin Stephanie Drlik von der Österreichischen Gesellschaft für Landschaftsarchitektur (ÖGLA).
Die Auswirkungen des Klimawandels sind längst in unseren Städten spürbar. Besonders in dicht bebauten Gebieten wie Wien wird die Frage immer drängender: Wie können wir unsere Stadt so gestalten, dass sie auch in Zukunft lebenswert bleibt?
Eine entscheidende Rolle spielt dabei die Klimaanpassung in der Stadtplanung. Begrünte Fassaden, kühlende Wasserflächen und durchdachte Freiraumgestaltung sind nur einige der Maßnahmen, die helfen können, die Stadt widerstandsfähiger zu machen. Doch was bedeutet das konkret für Wien? Welche Herausforderungen gibt es, und welche Lösungen sind bereits in Umsetzung?
Wir haben mit Stephanie Drlik, Landschaftsarchitektin und Expertin für nachhaltige Stadtentwicklung, über diese Fragen gesprochen. Im Interview gibt sie spannende Einblicke in aktuelle Projekte, innovative Ansätze und ihre Vision für ein klimaangepasstes Wien.
Noch ist es nicht allzu heiß auf Wiens Straßen. Spätestens ab Frühsommer wird sich das ändern. Wie wird Wien international im Bereich der Klimawandel-Infrastruktur wahrgenommen?
Stephanie Drlik: Mit großem Interesse, weil hier viel investiert, aber auch ausprobiert wird. Deswegen findet auch unsere Tagung in Wien statt. Wien hat als best practice Stadt in Sachen Klimawandelanpassung einen guten Ruf.
Eigentlich ist Wien eine ziemlich grüne Stadt….
Drlik: Das ja, aber das Grün ist in Wien ungerecht verteilt. Es gibt am Stadtrand ausgedehnte Naherholungsgebiete, im Zentrum die Parks, aber es gibt auch Bezirke, die fast gar keine grüne Infrastrukturen haben. Mit dem Klimawandel wird dies zu einem echten Problem, Stichwort: urbane Hitzeinseln, also hoch versiegelte Gebiete, die sich extrem aufheizen.
Was interessiert die Landschaftsplaner*innen an Wien besonders?
Drlik: Etwa wie in Wien mit dem Straßenraum umgegangen wird. Der shift von der Auto zentrierten Straße hin zum nutzungserweiterten Straßenraum. Da hat Wien schon einige sehr schöne Beispiele herzuzeigen. Aber nur Raum zu geben, reicht heute nicht mehr. Straßen werden zunehmend auch zu neuen Aufenthaltsräumen, da der Nutzungsdruck steigt. Je grüner, abwechslungsreicher und schöner die Straßen gestaltet sind, desto mehr werden sie auch angenommen.
Ein Beispiel?
Drlik: Etwa die kühle Meile Neubau entlang der Zieglergasse oder auch die nachbegrünte Neubaugasse, die Konzepte ziehen sich über die Mariahilfer Straße bis in den sechsten Bezirk. Da wurde übergeordnet geplant und umgesetzt. Ebenso bemerkenswert ist auch das Schwammstadt-Prinzip, das in Wien immer öfter zur Anwendung kommt. Also, den Regen nicht mehr nur über den Kanal abzuleiten, sondern mit neuer Technik etwa für die Straßenbäume zurückzuhalten und verfügbar zu machen.
Welche Bedeutung nimmt der Grünraum in den Stadtentwicklungsbieten ein?
Drlik: Eine sehr wesentliche. Etwa die Seestadt Aspern: ein riesiges neues Stadtgebiet, dass von einem See her gedacht und geplant wird. Anderswo, wie etwa am Nordwestbahnhof oder Nordbahnhof, sind es große Grünräume, von denen her geplant wird. Das macht einen Riesenunterschied zu früheren Entwicklungen. Die Wertigkeit hat sich da im positiven Sinn sehr verschoben.
Was sind aus Ihrer Sicht die passenden Strategien für den Klimawandel ?
Drlik: Ich denke es sind zwei Aspekte wichtig. Einerseits der konsequente Ausbau übergeordneter grüner Infrastruktur, in den Kleinstrukturen benötigen wir hingegen eine gewisse Flexibilität, da wir die genaue zukünftige Entwicklung des Klimas nicht abschätzen können. Da braucht es einen gewissen Spielraum.
Stichwort: Spielraum. Ich vermute, dass auch die Verwaltung grüner Infrastruktur so etwas braucht.
Drlik: Natürlich, die Frage ist etwa mit welcher Betreuungsintensität gerechnet werden muss. Aktuelle Beispiele, etwa die Freie Mitte im Nordbahnhofviertel zeigen ja, dass eine geplante naturnahe Gestaltung gut funktionieren kann. Nicht zu gestalten und Flächen als Stadtwildnis sich selbst zu überlassen ist freilich keine Lösung, dafür ist der Nutzungsdruck letztlich viel zu hoch.
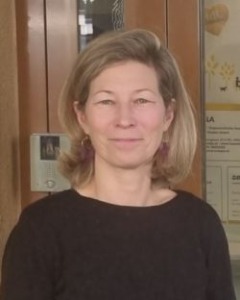 Fazit: Das Gespräch mit Stephanie Drlik hat gezeigt: Klimaanpassung ist längst kein Zukunftsthema mehr, sondern eine dringende Aufgabe der Gegenwart. Wien hat bereits einige Schritte unternommen, um sich an die veränderten klimatischen Bedingungen anzupassen – doch es bleibt noch viel zu tun. Von durchdachter Stadtbegrünung über innovative Wasser- und Kühlkonzepte bis hin zur Einbindung der Bevölkerung: Die Stadtentwicklung muss klimafit gedacht und gestaltet werden.
Fazit: Das Gespräch mit Stephanie Drlik hat gezeigt: Klimaanpassung ist längst kein Zukunftsthema mehr, sondern eine dringende Aufgabe der Gegenwart. Wien hat bereits einige Schritte unternommen, um sich an die veränderten klimatischen Bedingungen anzupassen – doch es bleibt noch viel zu tun. Von durchdachter Stadtbegrünung über innovative Wasser- und Kühlkonzepte bis hin zur Einbindung der Bevölkerung: Die Stadtentwicklung muss klimafit gedacht und gestaltet werden.
Eines wurde im Interview besonders deutlich: Jede Maßnahme zählt – und alle können mitwirken.
Das Interview führte Hans-Christian Heintschel von der Magistratsabteilung für Kommunikation und Medien.
INTERNATIONAL SYMPOSIUM: DESIGNING GREEN & RESILIENT CITIES
10. bis 12. April 2025
Es finden diverse Vorträge und eine abschließende Panel Diskussionen statt.
Ort: ehemalige Postbusgarage am Nordwestbahnhof (20., Nordwestbahnstraße 16)
Ausstellung zum Thema Landschaftsarchitektur und Klimawandel
11. und 12. April 2025, jeweils zwischen 14 und 18 Uhr
Der Eintritt ist frei.
Weitere Infos auch unter: Haus der Landschaft
Das könnte Sie auch interessieren:
🎧 Neuer Stadtteil am Nordwestbahnhof Podcast der Wiener Stadteilplanung „15 Fragen, 15 Minuten“
Wiener Klimafahrplan – Unser Weg zur klimagerechten Stadt

