5-Jahre Jubiläum Museum Nordwestbahnhof: Gekommen, um zu bleiben.

© Christopher Mavric
Was seinerzeit (2014-2017) mit einem Forschungsprojekt zu Transportwegen in Europa begann, hat sich zwischenzeitlich zu einer musealen Areal-Institution gemausert. Eine Zwischenbilanz.
Habt Ihr zu Beginn eigentlich von der Existenz des Nordwestbahnhofes gewusst?
Michael Zinganel: Nein, wir sind da ‚hineingestolpert‘. Es ging uns wie fast allen Wienerinnen und Wienern: wir kannten natürlich den Westbahnhof und den Südbahnhof, vom Nordbahnhof und vom Aspangbahnhof mit den Deportationen haben wir als geschichtsbewusster Menschen auch schon einmal gehört, aber der Nordwestbahnhof? Eigentlich hat mein Kollege Michael Hieslmair das Areal während seiner Spaziergänge mit seinen kleinen Kindern zufällig entdeckt.
Damals war ja der Bahnhof noch in Betrieb, oder?
Zinganel: Zu drei Viertel könnte man sagen. Die ganz großen Speditionen wie Schenker und Panalpina waren schon an den Rand der Stadt gesiedelt, Schenker hatte hier aber noch Lagerräumlichkeiten, wo unter anderem der Weihnachtsschmuck der Josefstädter Straße oder der Rotenturmstraße gelagert wurde. Der Container Terminal und die große Stückguthalle waren noch in Vollbetrieb und viele mittlere und kleinere Firmen aus dem Transportwesen noch vor Ort. Zuletzt waren da täglich noch um die 150 7,5 Tonnen LKWs für die täglichen Auslieferungen in die Stadt unterwegs. Was mir auch noch in Erinnerung ist: das alte Postamt des Bahnhofes, wo heute die Lauder Chabad-Schule untergebracht ist, wurde gerade erst zuggesperrt, als wir 2015 hier ankamen.
Wart ihr mit eurem Forschungsprojekt die ersten Zwischennutzungs-Pioniere am Areal?
Zinganel: Jein, es gab damals auch schon Zwischennutzungen, vorrangig aber aus dem Transportwesen. Aus dem kulturnahen Bereich war hier nur die Filmrequisitenfirma props.co jahrelang vor Ort.
Ich vermute, dass Ihr mit Eurem Forschungsprojekt zuerst einmal als kauzig und seltsam betrachtet wurdet.
Zinganel: Das war auch so. Es begann schon damit, dass wir mit unserem Ford Transit das kleinste Fahrzeug hatten und von den anderen belächelt wurden, da wir im Gegensatz zu richtigen LKWs nicht einmal an die existierenden Laderampen mit 1 Meter Höhe andocken konnten. Erst als wir begannen, mit unseren Nachbarn Interviews zu machen, veränderte sich das Verhältnis zum respektablen Nebeneinander.
Und die ÖBB als Eigentümer?
Zinganel: Das war ebenfalls ein längerer Weg. Auch hier haben Interviews mit aktiven und ehemaligen ÖBB Mitarbeitern den Weg bereitet. Offenbar wurde unser ernsthaftes Interesse an ihrer Arbeitswelt und an der materiellen Kultur des Areals, von der Werbetafel über Arbeitskleidung bis zu den auffälligen Wasserentnahme-Anzeigern, respektiert.
Euer „Museum Nordwestbahnhof“ klingt in diesem Zusammenhang ja auch respektabel.
Zinganel: Das haben wir auch bewusst so gewählt, erstens weil „Museum“ ein Begriff ist, der von allen in der Nachbarschaft verstanden wird und zweitens, damit unsere Informanten und Leihgeber stolz sein können, wozu sie beigetragen haben. Zugleich haben wir unterschätzt, dass ein Eintrag in Google Maps zur Folge hat, dass viele Besucher sich ein „richtiges Museum“ mit Shop, Kasse, Café Museumspädagogik und vernünftigen Öffnungszeiten erwartet haben, was wir als Ehrenamtliche gar nicht leisten können.
Kommen wir zu Gegenwart. Der Abbruch des Areals hat bereits gestartet, in knapp 10 Jahren werden hier um die 16.000 Menschen leben. Wie „rettet“ man das historische Bewusstsein dieses außergewöhnlichen Areals?
Zinganel: Ein pessimistisches Szenario wäre, dass alles abgerissen würde: nicht nur das Museum, sondern ebenso die Museums-Tankstelle, die Fisch-Installation oder etwa unsere Erinnerung an die antisemitische Hass-Ausstellung „Der ewige Jude“, und es daher keinerlei Spuren der Erinnerungsarbeit blieben. Ein utopisches Szenario wäre, dass sich die verschiedenen Abteilungen der Stadt dazu committen, parallel zur Entwicklung des Stadtviertels nicht nur einen einzigen, sondern mehrere Orte am Areal für die Vermittlung der unterschiedlichen Erinnerungsstränge vorzusehen.
Inwiefern liefert da das Nordbahnviertel eine mögliche Blaupause? Dort gibt es ja auch verschiedene Orte der Erinnerung.
Zinganel: Der Umgang mit Bestand war dort, speziell in der Freien Mitte, auch nicht völlig problemlos. Hier, am Nordwestbahnhof läuft gerade der Wettbewerb für die zukünftige Freiraumgestaltung. Dabei ist es uns gelungen, dass wir interessierten TeilnehmerInnen, Spaziergänge anbieten konnten, in denen wir unser Wissen über das Areal mit ihnen geteilt haben, natürlich mit der Hoffnung, dass davon auch etwas in die Planungen miteinfließt. Landschaftsplaner*innen sind ja immer dankbar, wenn es neben dem Programm auch inhaltliche Anhaltspunkte zur Inspiration des Entwurfes gibt.
Zwei historische Hallengebäude aus dem Bestand bleiben ja auch in Zukunft bestehen. Wie sieht es damit aus?
Zinganel: Das Verfahren ist unseres Wissens nach noch im Laufen. Die Widmung, die Qualitätskriterien im Verfahren und die Konzepte der Bauträger sehen eine Mischnutzung mit Kultur vor. Aber wie aufwendig die Hallen saniert und wie gewinnbringend sie daher betrieben werden, ist offen. Natürlich bieten sich gerade diese Hallen als Orte der Erinnerungsarbeit an, ohne dass man sie gleich als konventionelle Museen denken muss, unser Vorschlag wäre eine preisgünstige minimal-invasiv Sanierung Gebäude, um den Charakter zu erhalten, das dann für die gesamte Nachbarschaft als niederschwelliges Kulturzentrum dienen kann.
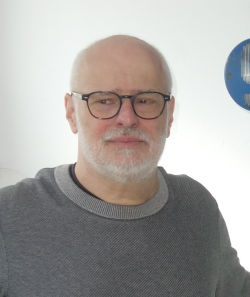 Fazit: Das Interview zeigt, wie Michael Zinganel und sein Team den Nordwestbahnhof als vergessenen Ort entdeckten und durch ihr Engagement ein Bewusstsein für dessen Geschichte schufen. Ihr Ziel ist es, Erinnerungen trotz Stadtentwicklung zu bewahren – etwa durch kulturelle Nutzung historischer Gebäude.
Fazit: Das Interview zeigt, wie Michael Zinganel und sein Team den Nordwestbahnhof als vergessenen Ort entdeckten und durch ihr Engagement ein Bewusstsein für dessen Geschichte schufen. Ihr Ziel ist es, Erinnerungen trotz Stadtentwicklung zu bewahren – etwa durch kulturelle Nutzung historischer Gebäude.
Das Interview führte Hans-Christian Heintschel von der Magistratsabteilung für Kommunikation und Medien.
Tracing Spaces – Museum Nordwestbahnhof
Tracing Spaces, 2012 als Verein von den Architekten, Ausstellungsgestaltern, Künstlern und Historikern Michael Zinganel und Michael Hieslmair gegründet, beschäftigte sich zuvor mit Logistikwegen zwischen Ost- und Westeuropa mit Wien als Drehscheibe, bevor sie sich auf das Areal des 1872 gegründeten Nordwestbahnhofes als ihrem vorrangigen Forschungsinteresse konzentrierten, mit seinen 44 Hektar Größe das letzte große innerstädtische Stadtentwicklungsprojekt Wiens. Zum Zeitpunkt des Interviews war Michael Hieslmair leider verhindert.
Das Museum Nordbahnhof (20., Nordwestbahnstraße 16) ist jeden Donnerstag zwischen 15 und 19 Uhr frei zugänglich, ebenso wie die Info-Ausstellungen „Stadtraum Nordwestbahnhof“ und das Info-Center der ÖBB. Infos zum aktuellen Programm: https://tracingspaces.net/programm/
Im Jahr 2022 publizierten die beiden zusammen mit dem Historiker Bernhard Hachleitner das prämierte Buch „Blinder Fleck Nordwestbahnhof. Biographie eines innenstadtnahen Bahnhofsareals.“, erschienen im Falter Verlag.
Es finden diverse Termine, Ausstellungen und Diskussionen statt. Das Programm finden Sie hier.
Das könnte Sie auch interessieren:
🎧 Neuer Stadtteil am Nordwestbahnhof Podcast der Wiener Stadteilplanung „15 Fragen, 15 Minuten“
Alle aktuellen Informationen zum Stadtentwicklungsgebiet Nordwestbahnhof finden Sie hier in der Vorhabenliste der Wiener Stadtplanung.
Geothermie-Probebohrungen am Nordwestbahnhofgelände
Nordwestbahnhof – Vom Güterumschlagplatz zum neuen Stadtteil

